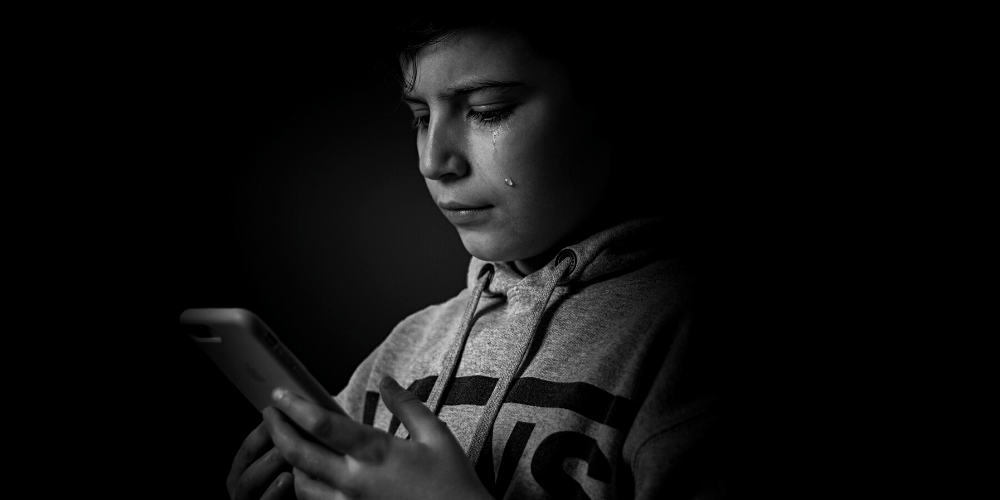Der Terminkalender von Dr. Suzanne Erb, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste (KJPD)St.Gallen ist voll. Für ein Interview hat sie ein Zeitfenster von 30 Minuten. Seit Jahren nimmt die Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen, die psychiatrische Hilfe benötigen zu. Corona habe die Lage noch verschärft – besonders Suizidalitäten hätten zugenommen.
Frau Dr. Suzanne Erb, wie würden Sie die aktuelle Lage bei den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten (KJPD) in St.Gallen beschreiben?
Wir haben sehr viel zu tun. Seit Jahren spüren wir einen Zuwachs von zehn bis dreizehn Prozent. Dieses Jahr waren es zu Beginn gar 20 Prozent mehr Kinder und Jugendliche, die uns mit ihren Familien aufsuchten. Seit Mitte Jahr sind die Zahlen etwas weniger angestiegen und pendeln sich auf hohem Niveau ein.
Kann man schon von einer Überlastung reden?
Wir versuchen dem natürlich mit all unseren Mitteln entgegenzuwirken und konnten zum Glück in diesem Jahr ein extra Notfallteam aufbauen, aber es fehlen Fachleute auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese zu finden, ist schwierig und dies verschärft die Situation, die durch viele Notfälle angespannt ist, noch weiter.